|
|
|
|

|

|
Liebe Leser:innen, liebe Kolleg:innen, liebe Ethikinteressierte,
die letzten Monate waren geprägt von vielen Veränderungen – auch am Zentrum für Gesundheitsethik. Dennoch konnten wir alle Tagungen und Kurse wie geplant durchführen und blicken auf ein intensives erstes Halbjahr zurück, in dem neben den Qualifizierungskursen für die Ethikberatung Veranstaltungen zu Themen wie Suizidprävention oder Gesundheitliche Versorgungsplanung (GVP) stattgefunden haben.
|
|
|
|
Aktuelle Einblicke in unsere Arbeit und zu einzelnen Themenbereichen finden Sie seit einigen Monaten auch auf Instagram unter @zfg_hannover. Referent:innen der Veranstaltungen stellen dort wichtige Aspekte ihrer Beiträge noch einmal auf den Punkt gebracht vor, und Teilnehmer:innen berichten von der Relevanz der ZfG-Tagungen für ihren jeweiligen beruflichen Kontext. Daneben teilen wir auch Aktuelles aus unserer Vortrags- und Forschungstätigkeit.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns, Sie im zweiten Halbjahr bei der einen oder anderen Gelegenheit begrüßen zu dürfen – in Präsenz oder digital!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten ZfG-Teams
Dorothee Arnold-Krüger
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Das Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG) feiert in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen!
Mit dem Ziel, den Fragen einer verantwortungsvollen Nutzung und Gestaltung in Medizin, Pflege, Biowissenschaften und Gesundheitswesen ein öffentliches Forum zu geben, wurde das ZfG im Jahr 1995 gegründet. Es ging dabei aus dem Sozialmedizinisch-Psychologischen Institut (SmPI) hervor, das im Jahr 1997 aufgespalten wurde in die „Hauptstelle für Lebensberatung“ (heute: Fachstelle für Psychologische Beratung des Zentrums für Seelsorge und Beratung (ZfSB)) und in das Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG). Beide Einrichtungen sind heute zumindest räumlich noch im Hanns-Lilje-Haus miteinander verbunden.
Seit der Gründung hat sich vieles verändert, Personen haben gewechselt, die Tagungsformate sind weiterentwickelt worden, und Veranstaltungen finden heute in unterschiedlicher Form statt, in Präsenz, online oder im hybriden Format. Geblieben ist aber der Fokus auf dem interdisziplinären Arbeiten und Austausch mit zahlreichen Kooperationspartner:innen sowie das wissenschaftlich fundierte Arbeiten an medizinethischen Fragestellungen, auch im Rahmen eigener Forschungsprojekte.
Von Beginn an arbeitete das ZfG eng mit der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) zusammen, der deutschsprachigen Fachgesellschaft für Ethik im Gesundheitswesen, und hier besonders im Qualifizierungsprogramm Ethikberatung im Gesundheitswesen. Dieses wird in Kooperation mit der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) und der Medizinische Hochschule Hannover (MHH) durchgeführt. Seit über zwanzig Jahren werden am ZfG Personen zu Ethikberater:innen ausgebildetet – inzwischen mehr als 2.300 Teilnehmer:innen. Im deutschsprachigen Raum ist das ZfG damit die Einrichtung, die am längsten ein solches Qualifizierungsprogramm anbietet.
Jedes Jahr werden zudem Tagungen zu aktuellen medizinethischen Fragestellungen, zu Innovationen und neuen Technologien oder veränderten Diskurslagen angeboten sowie zur Reflexion einer bereits etablierten Praxis und zu Grundsatzfragen. Als mittlerweile einziges kirchlich gebundenes Institut in Deutschland bietet das ZfG hier einen Raum für interdisziplinäre und interprofessionelle Diskurse und gestaltet diese gleichsam mit evangelisch ethischem Profil mit. Jährlich nehmen mehr als 1000 Personen an den verschiedenen Veranstaltungen des ZfG teil.
Wir danken allen Kooperationspartner:innen, Referent:innen und Teilnehmer:innen für großartige und intensive Veranstaltungen – und freuen uns auf die nächsten 30 Jahre!
Dr. Dorothee Arnold-Krüger
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Unter dem Motto „mutig – stark – beherzt“ fand vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 der Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover statt. Das Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG) war daran in unterschiedlicher Form beteiligt. Zusammen mit Kooperationspartner:innen der EKD und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) wurden Workshops zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Assistierter Suizid durchgeführt. Darin wurden theologische und medizinethische Perspektiven ins Gespräche gebracht. Die Veranstaltungen stießen auf breites Interesse und ermöglichten eine sachliche Auseinandersetzung mit komplexen ethischen Fragestellungen.
Das ZfG war zudem auf dem Markt der Möglichkeiten bei einem Stand vertreten, der in Kooperation von verschiedenen Akteur:innen der Hospizarbeit und Palliativversorgung der Region Hannover organisiert wurde.
Dr. Dorothee Arnold-Krüger moderierte zudem ein ökumenisches Konzert des Propsteichores St. Clemens und der Kantorei Herrenhausen zum 1700jährigen Jubiläum des Nizänischen Glaubensbekenntnisses.
Adam Liakos
|
|
|
|
|
Hintergrund
Ungewollte Kinderlosigkeit und Reproduktionsmedizin
|
|

|
Bild:
commons.wikimedia.org
|
|
|
Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein verbreitetes Phänomen. Veränderte Lebensbedingungen führen dazu, dass Paare immer später mit der Familiengründung beginnen. Damit steigt das Risiko, dass es mit der Realisierung der gewünschten Familiengröße nicht mehr klappt, oder zumindest nicht auf natürlichem Weg. Dies spiegelt sich auch in den Statistiken der Reproduktionsmedizin: Während 2013 im Deutschen IVF-Register noch 80.955 Behandlungszyklen dokumentiert wurden, waren es 10 Jahre später schon 127.973.
Die steigende Nachfrage nach reproduktionsmedizinischer Unterstützung bei der Erfüllung des Kinderwunsches wirft vielfältige Fragen auf. Für die Betroffenen ist die Erkenntnis, dass sie „unfruchtbar“ sind, häufig ein Schock. Sie müssen entscheiden, wie weit sie für die Chance auf ein Kind gehen, welche emotionalen, körperlichen und finanziellen Belastungen sie dabei auf sich nehmen und wie sie sich neu orientieren wollen, wenn die Behandlung erfolglos bleibt. Hierbei kann eine psychosoziale Beratung hilfreich sein.
Auf einer gesellschaftlichen Ebene stellt sich die Frage, ob und wie dem Trend zur späten Familiengründung entgegengewirkt werden kann und unter welchen Voraussetzungen die Kosten für eine reproduktionsmedizinische Behandlung von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden sollen. Aktuell liegt der Eigenanteil für drei Behandlungszyklen selbst im günstigsten Fall bei mehreren tausend Euro. Dass dies für viele Paare eine kaum zu überwindende Hürde darstellt, dürfte auf der Hand liegen. Beim Thema Reproduktionsmedizin geht es daher diesseits der Debatte um kontroverse Technologien und Anwendungsfelder auch ganz elementar um soziale Gerechtigkeit.
Ruth Denkhaus
|
|
|
|
|
Zum Weiterdenken
KI Entscheidungssituationen am Lebensende
|
|
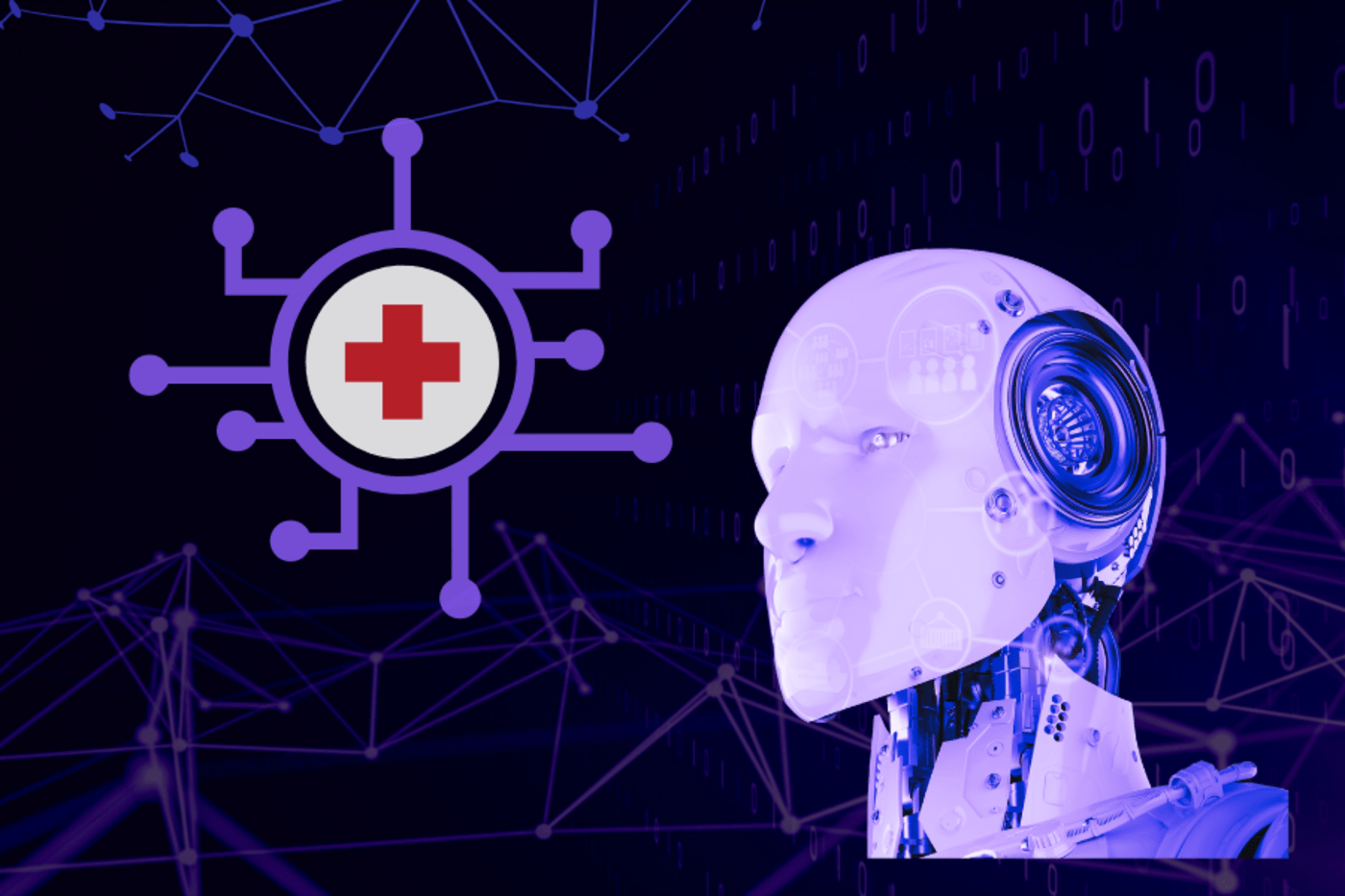
|
|
Künstliche Intelligenz (KI) hat in der aktuellen ethischen Debatte große Aufmerksamkeit erlangt – und das zu Recht. Führende Stimmen aus Industrie und Forschung prognostizieren tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen, da zunehmend leistungsfähige KI-Systeme eingesetzt werden, um auf immer komplexere gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Befürworter:innen von KI betonen insbesondere ihr enormes Potenzial im medizinischen Bereich. In der Folge werden politische Entscheidungsträger:innen, Entwickler:innen – und in der Konsequenz auch die KI-Systeme selbst – in den kommenden Jahren mit konkreten moralischen Entscheidungen konfrontiert sein. Vor diesem Hintergrund müssen Forschende in der moralpsychologischen Grundlagenforschung klären, welche Entscheidungen KI treffen darf – und welche nicht. In einer sich rasant entwickelnden technologischen und gesellschaftlichen Landschaft ist diese Forschung relevant, um ethische Grenzverläufe zu erkennen oder zu überdenken.
Ein internationales Forschungsteam um Laakasuo et al. (2025) hat sich dieser Frage nun in einer groß angelegten Studie gewidmet. In acht Experimenten mit insgesamt 5837 Teilnehmenden untersuchten die Forschenden, wie Menschen moralische Urteile über Entscheidungen am Lebensende fällen – abhängig davon, ob diese Entscheidungen von einem Menschen oder von einer KI getroffen wurden. Im Mittelpunkt standen dabei Behandlungsentscheidungen in der Palliativmedizin, insbesondere im Hinblick auf ein Phänomen, das als „human-robot asymmetry effect“ bekannt ist. Dieser beschreibt die Tendenz, Entscheidungen von KI härter zu bewerten als identische Entscheidungen von Menschen – ein Effekt, der in der moralpsychologischen Forschung vielfach belegt ist. Die Studie konzentrierte sich zudem bewusst auf die Einschätzungen von Laien – nicht von Mediziner:innen oder Informatiker:innen.
Die Teilnehmenden erhielten jeweils eine von mehreren hypothetischen Entscheidungssituationen am Lebensende. Anschließend wurde ihnen mitgeteilt, welche Behandlungsmaßnahme von einem menschlichen oder einem KI-„Arzt“ getroffen wurde. Im Mittelpunkt standen Entscheidungen zur Fortführung oder zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen. In einem Teil der Experimente erfassten die Forschenden jedoch auch Reaktionen auf ein breiteres Spektrum hypothetischer Behandlungsformen und -verläufe. Dazu gehörten unter anderem die Verabreichung einer tödlichen Injektion auf Wunsch der Patientin bzw. des Patienten – eine Maßnahme, die in Deutschland strafrechtlich verboten ist –, das Zurückhalten lebensrettender Maßnahmen sowie unbeabsichtigte Todesfälle infolge risikoreicher Behandlungen.
Die Experimente wurden so aufgebaut, dass die Forschenden Variablen wie die Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen, das Maß an Patientenautonomie und die wahrgenommene Kompetenz menschlicher bzw. KI-„Ärzte“ gezielt verändern konnten. Sowohl diese experimentellen Variationen als auch die Auswahl der hypothetischen Behandlungsszenarien dienten dazu, mögliche Randbedingungen für den sogenannten Roboter-Mensch-Asymmetrie-Effekt zu identifizieren. Im Anschluss beurteilten die Teilnehmenden die moralische Vertretbarkeit dieser Entscheidungen.
Die Ergebnisse zeigen: Der Asymmetrieeffekt bleibt auch im Kontext der Palliativversorgung bestehen – jedoch hängt seine Stärke von bestimmten Bedingungen ab. Entscheidungen von KI-Systemen wurden besonders dann sehr kritisch bewertet, wenn sie zur Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen führten – und zwar sowohl wenn die KI lediglich Empfehlungen abgab als auch, wenn sie die Entscheidung selbst traf. Situationen, in denen die Autonomie von Patient:innen eingeschränkt war – etwa, wenn diese bewusstlos waren –, wurden bei KI-„Ärzten“ deutlich kritischer bewertet als bei menschlichen Ärzt:innen. Auch zeigte sich eine Präferenz für transparente Algorithmen. Interessanterweise schwächte sich der Asymmetrieeffekt ab, wenn sowohl menschliche als auch KI-Ärzte als hochkompetent wahrgenommen wurden – was darauf hindeutet, dass moralische Bewertungen gegenüber KI-Systemen im medizinischen Kontext milder ausfallen könnten, je leistungsfähiger diese werden.
Das Forschungsteam betont allerdings, dass es bislang kein übergreifendes Modell zur Bewertung moralischer Urteile gegenüber KI in unterschiedlichen Kontexten gibt. Weitere Studien sind notwendig, um zukünftige gesetzliche und technologische Entwicklungen ethisch fundiert zu begleiten. Dennoch sind diese Ergebnisse hochrelevant – insbesondere mit Blick auf sensible Bereiche wie die Intensiv- und Palliativmedizin. Die Studie macht deutlich, wie eng technologische Innovation mit moralpsychologischen Bewertungen verknüpft sein kann. Erkenntnisse dieser Art sollten aktiv in die Entwicklung gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie in die Gestaltung von KI-Systemen einfließen – insbesondere, wenn es darum geht, Autonomie, Transparenz, Vertrauen und menschliche Verantwortung zu gewährleisten.
Adam Liakos
Zitierte Quelle:
Laakasuo, M., Kunnari, A., Francis, K., Košová, M. J., Kopecký, R., Buttazzoni, P., Koverola, M., Palomäki, J., Drosinou, M., & Hannikainen, I. (2025). Moral psychological exploration of the asymmetry effect in AI-assisted euthanasia decisions. Cognition, 262, 106177. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2025.106177
|
|
|
|
|
Hintergrund
Kunst, Gesundheit und Ethik: Eine notwendige Begegnung
|
|

|
Bild:
Daniel Eduardo Restrepo Meléndez
|
|
|
Kunst, Gesundheit und Ethik teilen ein tiefes Interesse am menschlichen Leben mit seinen komplexen Dimensionen, besonders, wenn es um fragile Lebenssituationen geht. Kunst beeinflusst die Gesundheit von Patient:innen auf vielfältige Weise: Sie ermöglicht emotionale Ausdrucksformen, lindert Leiden und stärkt das psychische Wohlbefinden.
Im Gesundheitsbereich bedeutet die Integration von Kunst und Ethik, Wohlbefinden über das Körperliche hinaus zu denken – auch emotional, sozial und kulturell. Kunst ist dabei kein bloßer Schmuck, sondern ein lebendiges Werkzeug, um mit Sinn und Menschlichkeit zu begegnen. Aus ethischer Sicht bedeutet dies die Förderung von Werten wie Würde, Autonomie und Respekt vor der Subjektivität des Patienten, durch Musik, Malerei oder Schreiben können Ängste, Trauer und Schmerzen verarbeitet werden – das fördert Ruhe und innere Stärke. Außerdem reduzieren künstlerisch gestaltete Klinikräume nachweislich Stress und schaffen eine menschlichere Atmosphäre. Im Kontext der Pflege ist Kunst nicht nur Dekoration; sie schafft liebevollere Beziehungen, fördert die Humanisierung von Pflegebereichen und verleiht schwer fassbaren Erfahrungen eine Stimme.
Die Anerkennung des Wertes der Kunst im Gesundheitswesen ist auch ein Aufruf zur Veränderung der Pflegesysteme: hin zu Modellen, die menschlicher, kreativer und ethisch dem Leben eines jeden Patienten verpflichtet sind.
Adrián Camilo Restrepo Meléndez
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Zentrum für Gesundheitsethik
an der Ev. Akademie Loccum
Knochenhauer Str. 33 30159
Hannover T: 0511 1241-496
E-Mail: zfg@evlka.de
|
|
|
|
|
|
|
|
