|
|
|
|

|

|
Liebe Leser*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Ethik-Interessierte,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, der Advent beschenkt uns mit seinem Lichterglanz - in den Büroräumen des ZfG kommt aktuell noch der fröhliche Lärm des Adventsmarktes hinzu. Der erfolgreiche Abschluss der letzten Veranstaltungen liegt hinter uns und wir blicken dankbar und stolz auf die vielen Highlights dieses Jahres.
|
|
|
|
Die jüngste Zeit war daneben geprägt von verschiedenen, zum Teil sehr kurzfristig angekündigten Gesetzesvorhaben zu gesundheitsethisch relevanten Themen. Sie erforderten oft schnelle Reaktionen und Reflexionen. Dabei zeigte sich, wie wichtig eine langfristige Bearbeitung und Begleitung solcher bestehender, dahinterliegender Debatten, z.B. zum Schwangerschaftsabbruch oder zur Organspende, ist. Aus dieser Expertise heraus sind dann auch kurzfristige Einordnungen möglich.
Wir danken an dieser Stelle allen ganz herzlich, die in diesem Jahr in den verschiedenen Diskussionen, Projekten und Veranstaltungen mit uns über Fragen der Gesundheitsethik nachgedacht, zu Themen geforscht und in praktischen Kontexten Argumente abgewogen haben, für die gelungene Zusammenarbeit und Bereicherung in allen Debatten.
Wir wünschen Ihnen und allen, mit denen Sie verbunden sind, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!
Es grüßt Sie im Namen des Zentrums für Gesundheitsethik
Ihre Julia Inthorn
|
|
|
|
|

|
Weihnachtsgruß
Das Team des Zentrums für Gesundheitsethik wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Im Zentrum für Gesundheitsethik stehen größere Veränderungen an.
Dr. Julia Inthorn verlässt das ZfG Ende März 2025 und wird ab Sommersemester 2025 als Professorin für Angewandte Ethik an der Hochschule für Philosophie in München tätig sein. Die Stelle der Direktorin wird neu ausgeschrieben. Die kommissarische Leitung des ZfG übernimmt in der Zwischenzeit die theologische Referentin, Dr. Dorothee Arnold-Krüger. Darüber hinaus wird das Forschungsprojekt STRONG und sein Team an die Uniklinik der RWTH Aachen wechseln. Auslöser ist der Wechseln von Prof. Dr. Helen Kohlen an die Uniklinik Aachen. Erste Zwischenergebnisse des Projekts werden auf einer Tagung des ZfG in Kooperation mit STRONG im Oktober 2025 in Hannover präsentiert und diskutiert.
|
|
|
|
|
Aktuelles
Urteil zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen
|
|

|
|
Ärztliche Zwangsmaßnahmen gegenüber nicht einwilligungsfähigen betreuten Personen sind nur als letztes Mittel zulässig und an strenge Voraussetzungen gebunden. Eine Voraussetzung ist, dass die Person in einem Krankenhaus versorgt wird.
In seinem Urteil vom 26. November hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden, dass es begründete Ausnahmefälle geben kann, in denen zum Schutz der Person vor weiterem Schaden diese Voraussetzung nicht erfüllt sein muss.
Dem Urteil ist eine breite, kontroverse Debatte vorausgegangen. Im Zentrum stand der Schutz von besonders vulnerablen Personen und die besonders komplexe Abwägung von Nutzen und Schaden in Bezug auf Zwangsmaßnahmen.
|
|
|
|
|
Gesundheitsrecht aktuell
Last-Minute-Gesetzesvorhaben: Schwangerschaftsabbruch und Organspende
|
|
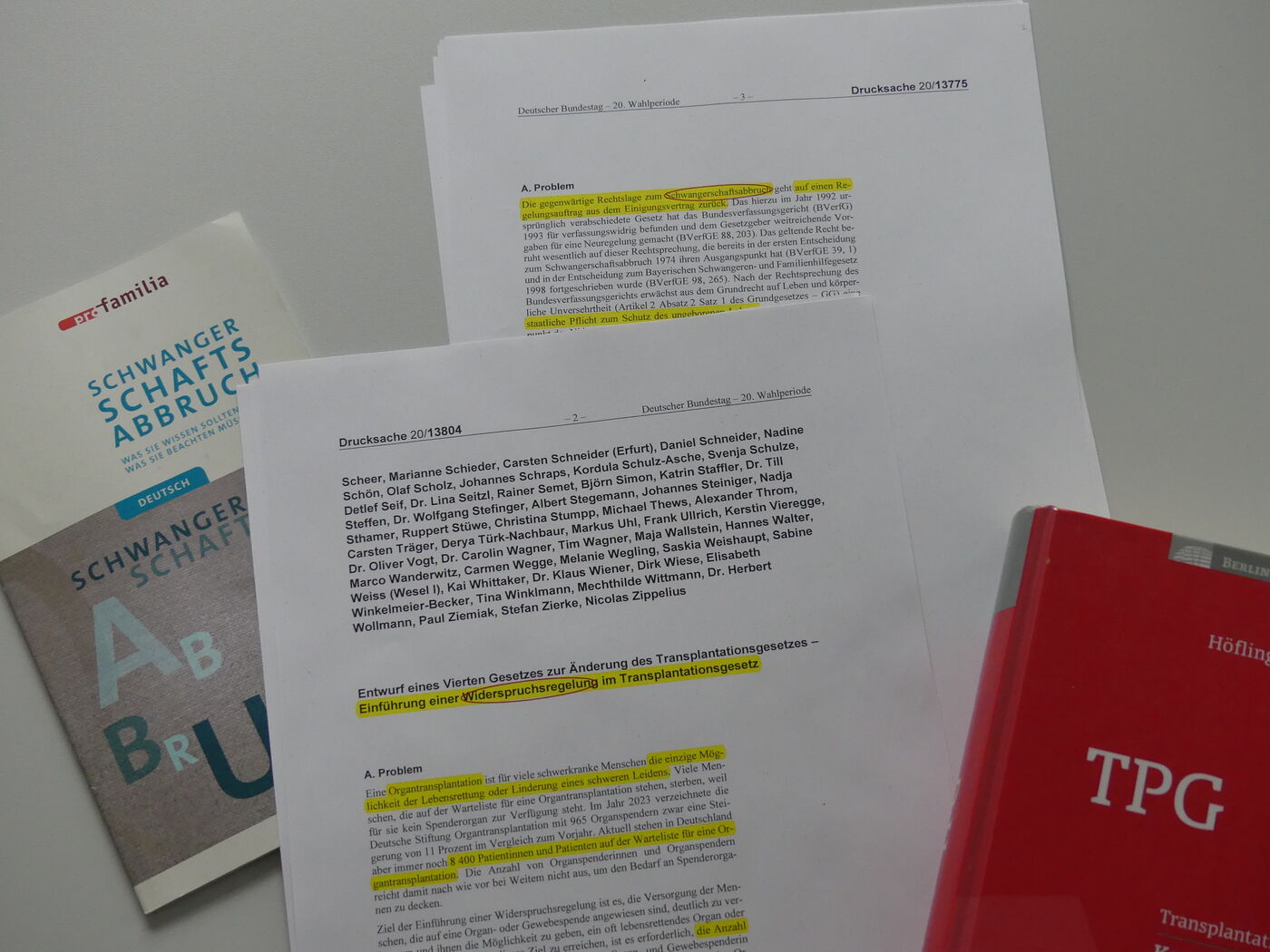
|
|
Kurz vor dem vorgezogenen Ende der Legislaturperiode sind noch zwei Gesetzentwürfe zu ethisch hoch kontroversen Themen in den Bundestag eingebracht worden. Der erste sieht eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs vor. Im Einklang mit den Empfehlungen der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin sollen Schwangerschaftsabbrüche während der ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis in Zukunft rechtmäßig sein (und von den Gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden), wenn die Schwangere sich vorher beraten lassen hat. Die aktuell geltende Bedenkzeit von drei Tagen zwischen Beratung und Eingriff soll wegfallen.
Der zweite Gesetzentwurf stellt – nach dem gescheiterten Anlauf 2019 – einen erneuten Versuch dar, die Widerspruchslösung bei der Organspende einzuführen. Mit Ausnahme von Minderjährigen und nicht einwilligungsfähigen Personen sowie Personen, die vor weniger als zwölf Monaten nach Deutschland eingereist sind, sollen in Zukunft alle Personen, die einer Organ- oder Gewebespende nicht widersprochen haben, als Spender*innen in Frage kommen. Den nächsten Angehörigen soll kein eigenes Entscheidungsrecht mehr zustehen.
Beide Gesetzentwürfe sind am 5. Dezember im Plenum beraten und an die federführenden Ausschüsse überwiesen worden. Ob sie in den letzten beiden verbleibenden Sitzungswochen des Parlamentes 2025 noch zur Abstimmung kommen, ist unklar. Wenn ja, werden die Abgeordneten – wie immer, wenn es um grundlegende ethische Fragen geht – ohne Fraktionszwang abstimmen.
|
|
|
|
|
Hintergrund
Digitalisierung im Gesundheitsbereich
|
|
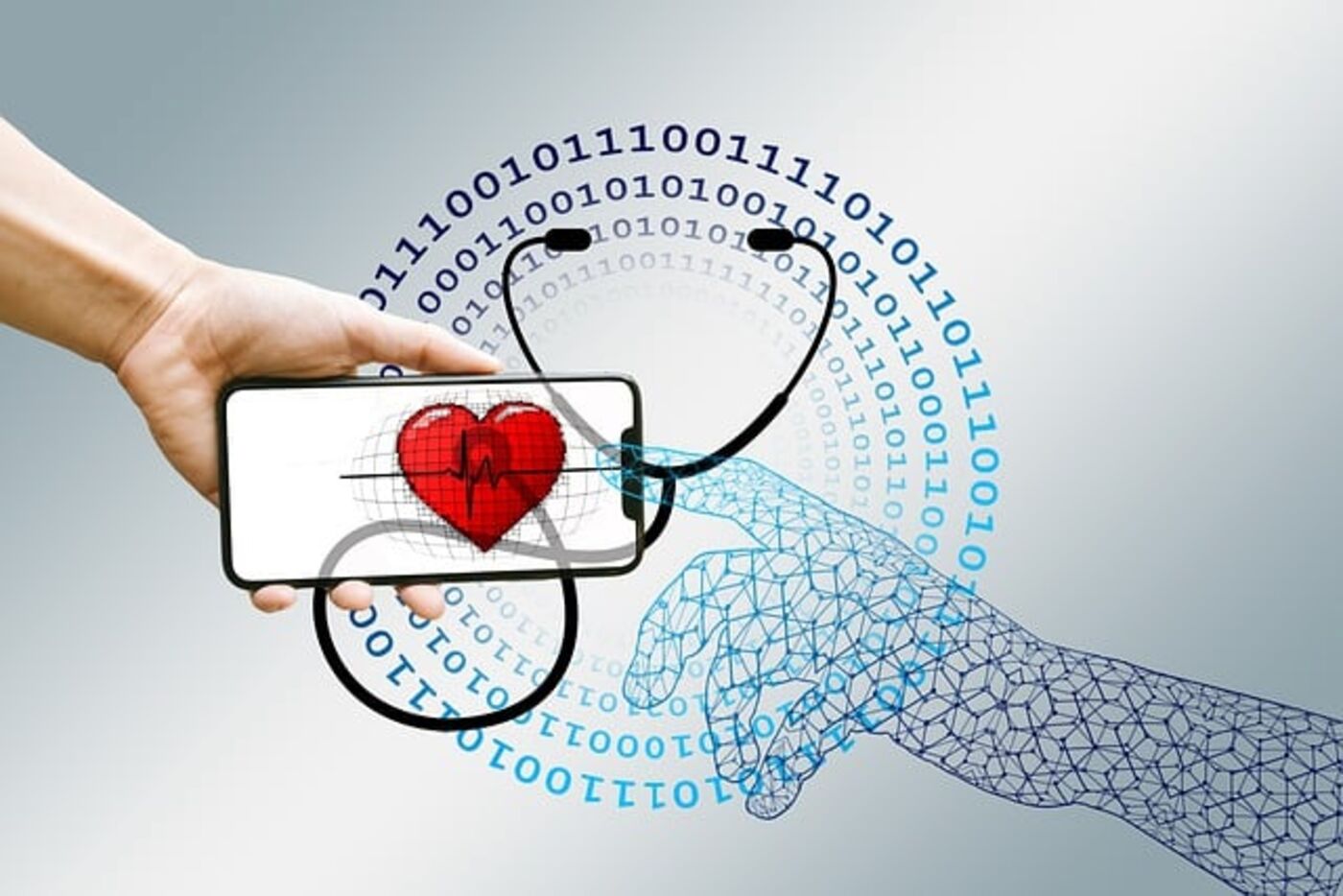
|
|
Wir treten in ein neues digitales Zeitalter ein, in dem sich viele Veränderungen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens vollziehen. Im Gesundheitswesen kann die Digitalisierung dazu beitragen, den Zugang zu Informationen zu verbessern, die Qualität der Pflege zu erhöhen und die Privatsphäre der Patient:innen besser zu schützen. Sie verringert auch die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler, die beispielsweise mit dem Lesen unleserlicher Handschrift oder dem Verlust physischer Dokumente verbunden sind.
Um diese Vorteile nutzen zu können, erfordert die digitale Transformation im Gesundheitswesen nicht nur technische Fortschritte, sondern auch einen Wandel in der Einstellung alle Beteiligten, eine Art Alphabetisierung in der Nutzung der neuen Technologie, die langfristig neben Wissen auch eine Anpassung der Kultur des Gesundheitspersonals umfasst. Die Bioethik versucht diesen Kulturwandel so mitzugestalten, dass die Auswirkungen unseres Handelns auf Dritte berücksichtigt und Fehlern der Vergangenheit vermieden werden, um eine gerechtere und ausgewogenere Zukunft zu gewährleisten. Dazu gehören u. a. die Minimierung des Risikos von Diskriminierung und Sicherung der Inklusivität, d.h. dass auch Menschen, die über geringe digitale Kompetenzen verfügen, Zugang haben und nicht abgehängt werden
|
|
|
|
|
Zum Weiterdenken
Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit
|
|

|
|
Das Armutsrisiko ist in Deutschland, trotz bestehender sozialer Sicherungssysteme, für bestimmte Personengruppen deutlich höher als für andere. Ein Blick in die Statistiken genügt (vgl. auch die Zusammenstellung der Diakonie Deutschland). Darüber hinaus besteht weiterhin ein enger Zusammenhang von Armut und Gesundheit. Fragen von Gesundheit und Gerechtigkeit beginnen damit weit vor den Fragen des Zugangs zu medizinischer Versorgung.
|
|
|
|
|
Das ethische Stichwort
Das Dammbruchargument: Umstritten, nicht nur in medizinethischen Diskursen
|
|
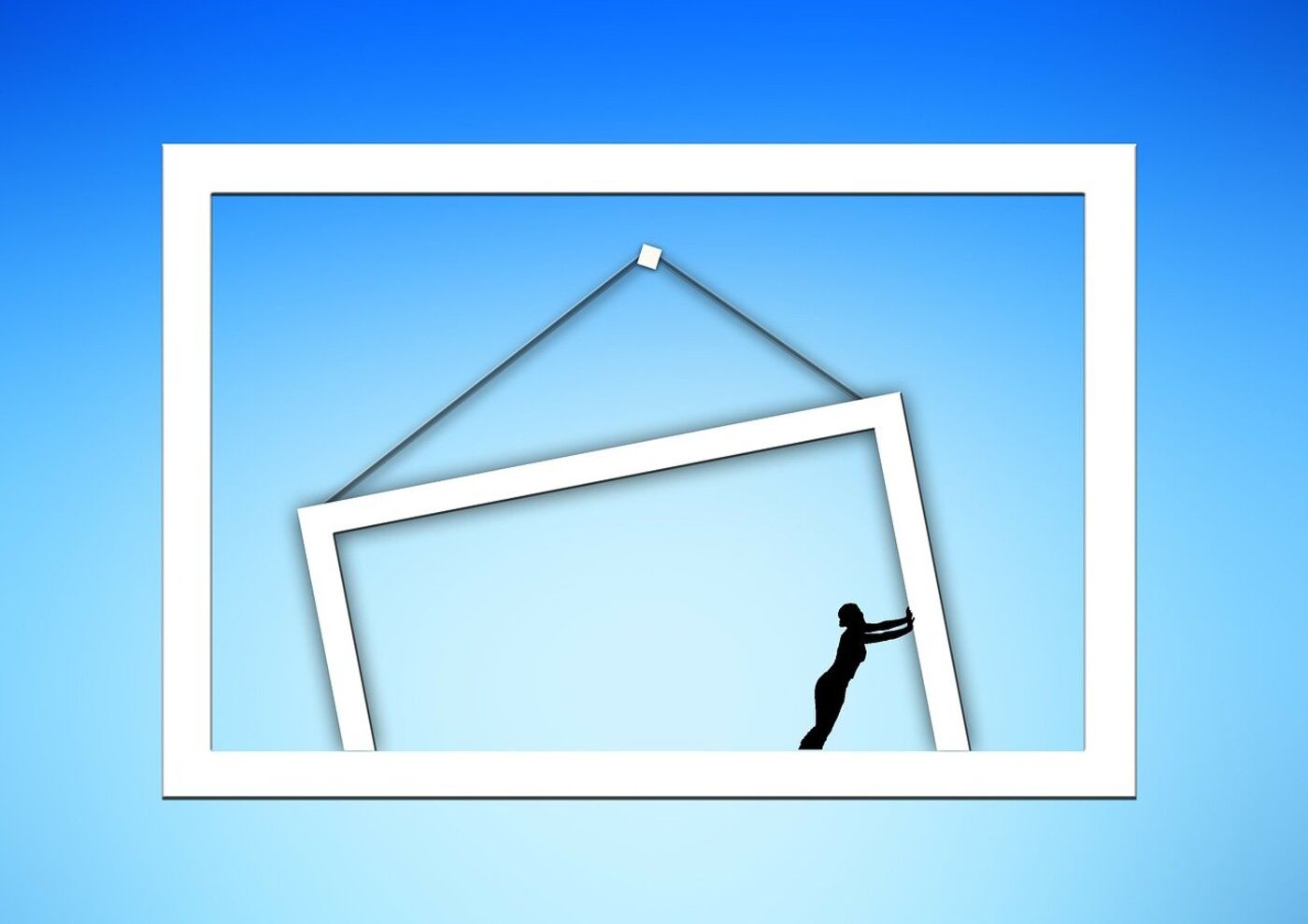
|
|
Das Dammbruchargument ist eine Argumentationsfigur, die sowohl in fachbezogenen Kontexten, wie beispielsweise im Diskurs um den Schwangerschaftsabbruch oder den Assistierten Suizid, als auch in Alltagssituationen zur Anwendung kommt. Dabei wird eine Handlung oder Entscheidung zunächst als ethisch rechtfertigbar beurteilt. Sie wird dennoch ethisch zurückgewiesen mit der Begründung, dass ihr nicht kontrollierbar eine Fülle an weiteren, nicht wünschenswerten und nicht mehr zu rechtfertigenden Schritten folgt, die auf Grund der ersten Entscheidung nicht mehr zurückgenommen werden können – „der Damm“ also „bricht“.
Dammbruchargumente sind umstritten, da sie Aussagen über die Zukunft machen, für die es in den allermeisten Fällen schwer bis unmöglich ist, Wahrscheinlichkeiten des Eintreffens dieser unerwünschten Konsequenzen zu kennen und diese darüber hinaus zu beziffern. Sie sind auch problematisch, wenn mit ihnen in Debatten Bedrohungsszenarien heraufbeschworen werden. Gleichzeitig können Überlegungen zum Dammbruch aber auch ein hilfreiches heuristisches Mittel sein, um sich gesellschaftlich über mögliche Entwicklungen und deren Bewertung zu verständigen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Zentrum für Gesundheitsethik
an der Ev. Akademie Loccum
Knochenhauer Str. 33 30159
Hannover T: 0511 1241-496
E-Mail: zfg@evlka.de
|
|
|
|
|
|
|
|
